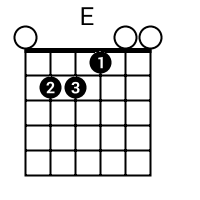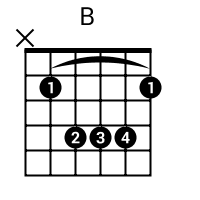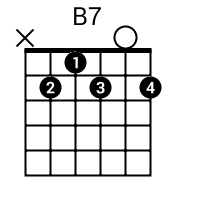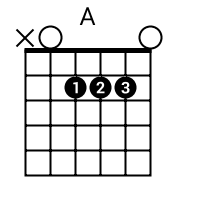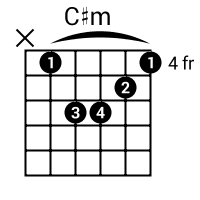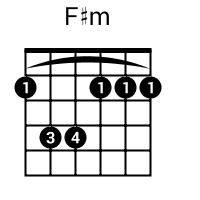DAS STEIGERLIED

Steigerlied
Und er
und er
![]()
1. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt,
und er hat sein helles Licht bei der Nacht,
und er hat sein helles Licht bei der Nacht
schon angezündt, schon angezündt.
2. Hat’s angezündt, ´s wirft seinen Schein,
und damit so fahren wir bei der Nacht,
und damit so fahren wir bei der Nacht
ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein.
3. Ins Bergwerk ein, wo die Bergleut‘ sein,
die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht,
die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht
aus Felsgestein, aus Felsgestein.
4. Der eine gräbt das Silber, der andere gräbt das Gold.
Und dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht,
und dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht
dem sein sie hold, dem sein sie hold.
5. Ade, Ade! Herzliebste mein!
Und da drunten in dem tiefen, finstren Schacht bei der Nacht,
und da drunten in dem tiefen, finstren Schacht bei der Nacht,
da denk ich dein, da denk ich dein.
6. Und kehr‘ ich heim zur Liebsten mein,
dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht:
dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht:
Glück auf, Glück auf !!! Glück auf, Glück auf !
7. Wir Bergleut‘ sein, kreuzbrave Leut‘,
denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht,
denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht
und saufen Schnaps, und saufen Schnaps!